„An Quelle führt kein Weg vorbei.“ Was wie artikelloses Kiezdeutsch klingt, war einer der bekanntesten Werbeslogans der Siebziger. Quelle war damals bekannter als der bunte Hund, und in deutschen Haushalten erwartete man mit Spannung zweimal jährlich den dicken Katalog. Ach ja, die Quelle! Das war Europas größtes Versandhaus, wo man von der Latzhose bis zum Laufgitter alles bestellen konnte. Bis zur Auflösung und der anschließenden Verschacherung des Unternehmens vor gut zehn Jahren. Und es gab nicht nur den Versandhandel, sondern auch große Warenhäuser, eine eigene Bank, einen Reiseveranstalter sowie viele Technikläden, die sich über ganz Deutschland verteilten. Nun ist das alles Vergangenheit und das ehemalige Familienunternehmen mit der prägnanten Hand im Logo existiert nur noch in alten Katalogen, Fotos und natürlich der Erinnerung. Und genau dort beginnt die Ausgrabung eines der großen Kapitel deutscher Konsumgeschichte.

Quelle – von Versandkatalogen und Technikläden
Quelle – Aufstieg und Fall eines Versandriesen
Als der Jungunternehmer Gustav Schickedanz im Jahre 1927 in den Versandhandel einstieg, konnte er sich bestimmt nicht ausmalen, dass sein Lebenswerk irgendwann einmal Milliardenumsätze machen wird. Und sein Unternehmen mehr als 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Wie immer fing alles ganz klein und klassisch an. Der Geschäftsmann führte in Fürth einen kleinen Laden für Kurz- und Wollwaren und wusste, dass die Zeit nach dem Krieg einen Großteil der Bevölkerung zu größter Sparsamkeit gezwungen hatte. Gleichzeitig bestand ein immenser Nachholbedarf an Gütern jeglicher Art. Um den Menschen zu helfen und gleichzeitig unternehmerisch erfolgreich zu sein, mussten die günstigsten Preise her, um alle Schichten zu versorgen. Soweit die Theorie. Mit dem Einzelhandel war das aber kaum möglich, da nur durch großhandelsübliche Mengen die Tiefpreise an den Kunden weitergegeben werden konnten.
Die Lösung lag auf der Hand: Ein für damalige Verhältnisse großes Lager und die Gründung eines eigenen Versandhandels, der nicht nur die Leute in den Städten bediente, sondern in der Weimarer Republik auch die abgeschnittene Landbevölkerung, die im Gegensatz zu heute nicht mal eben in die Stadt zum Einkauf fahren konnte. Das Quelle-Versandhaus war geboren. Und ein Jahr später erschien auch der erste Katalog. Noch völlig schlicht auf einfaches Papier bedruckt und ohne Farbe. Die meisten Abbildungen waren nüchterne Zeichnungen und keine Fotografien. Diese Reduktion auf das Nötigste war aber weder übertriebene Sparsamkeit noch Dilettantismus, sondern geschickte Strategie von Gustav Schickedanz, um erst einmal Vertrauen zu schaffen, indem man den Leuten vermittelt, dass Quelle zu ihnen gehört. Ein Großteil der Katalogware bestand dementsprechend aus Dingen, die am nötigsten gebraucht wurden: Ersatzteile und Produkte des täglichen Bedarfs, alles ohne Dekoration und Pracht.
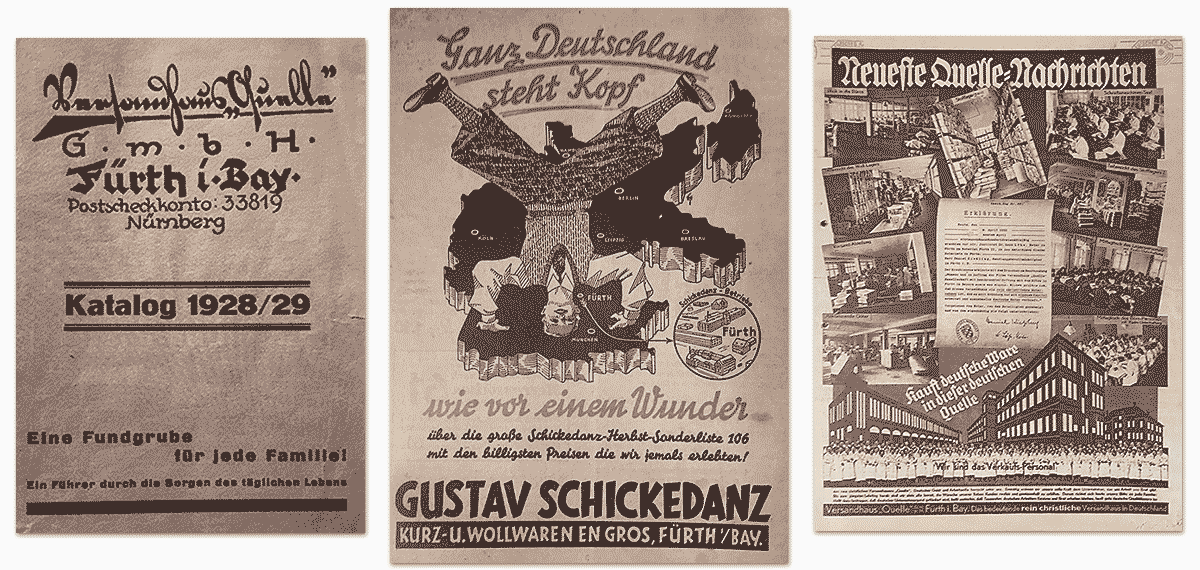
Der erste Quelle-Katalog von 1928. Daneben für Einzelhändler die Sonderliste von 1932 für Kurzwaren. Rechts die Quelle-Nachrichten von 1933 mit der notariellen Beglaubigung der Quelle als „rein christliches“ Unternehmen, das ausschließlich deutsche Ware verkauft.
Gustav Schickedanz wusste aber auch, dass die Beschränkung der Waren auf rein funktionale Artikel sein Unternehmen leicht in die Ramschecke rücken könnte. Also tat er das, was man als weitsichtiger Unternehmer tut. Er hielt die Balance. Und zwar zwischen den einfachen, rein funktionalen und den schönen, teureren Dingen. Die für jene Menschen gedacht waren, die sich auch mal wieder etwas gönnen wollten und konnten. Zusätzlich warb er mit Qualität und Markenartikeln und führte mit der Garantie etwas Neues ein. Er garantierte nämlich bei allen Produkten nicht nur ein Umtauschrecht bei Nichtgefallen, sondern auch ein Rückgaberecht, wenn das Produkt irgendwo anders günstiger zu finden wäre. Die Quelle sprudelte und wurde bei den Kunden beliebt. Und der Unternehmer musste sich neben neuen logistischen Herausforderungen auch mit dem Problem befassen, wie man den enorm wachsenden Kundenstamm in einer Adresskartei unterbringt und geschickt verwaltet. Moderne Datenbanken waren noch Zukunftsmusik, und zigtausend Kunden ohne vernünftiges System mit Zetteln zu führen glich Sisyphusarbeit.
Das Jahr 1929 brachte gleich zwei Katastrophen. Einmal kamen seine Ehefrau, sein Vater und sein Sohn bei einem Autounfall ums Leben. Und dann kam der Schwarze Freitag und läutete die Weltwirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit und dem Zusammenbruch vieler Unternehmen ein. Anstatt aber den Kopf in den Sand zu stecken, warf sich Gustav Schickedanz in Arbeit und hielt sein Unternehmen mit dem Konzept aus Qualität und günstigsten Preisen weiter auf Kurs. Aus dem kleinen Versandgeschäft, das er anfangs noch mit Handzetteln in Briefkästen bewarb, war 1932 bereits ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern geworden, das sich größere Betriebsgebäude suchen musste. Die schwere Krisenzeit schien überstanden, nicht ahnend, dass die nächste Herausforderung bereits vor der Tür stand. Denn nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler dauerte es nicht lange, bis eines der Wahlversprechen der NSDAP, jüdisches Großkapital zu zerschlagen, durch landesweite Boykottaufrufe in die Tat umgesetzt wurde. Und ein florierender Versandhandel wie die Quelle roch schon arg nach Großkapital. Das bekam man durch verunsicherte Kunden zu spüren, die sich fragten, ob man bei Quelle weiterhin kaufen dürfe.
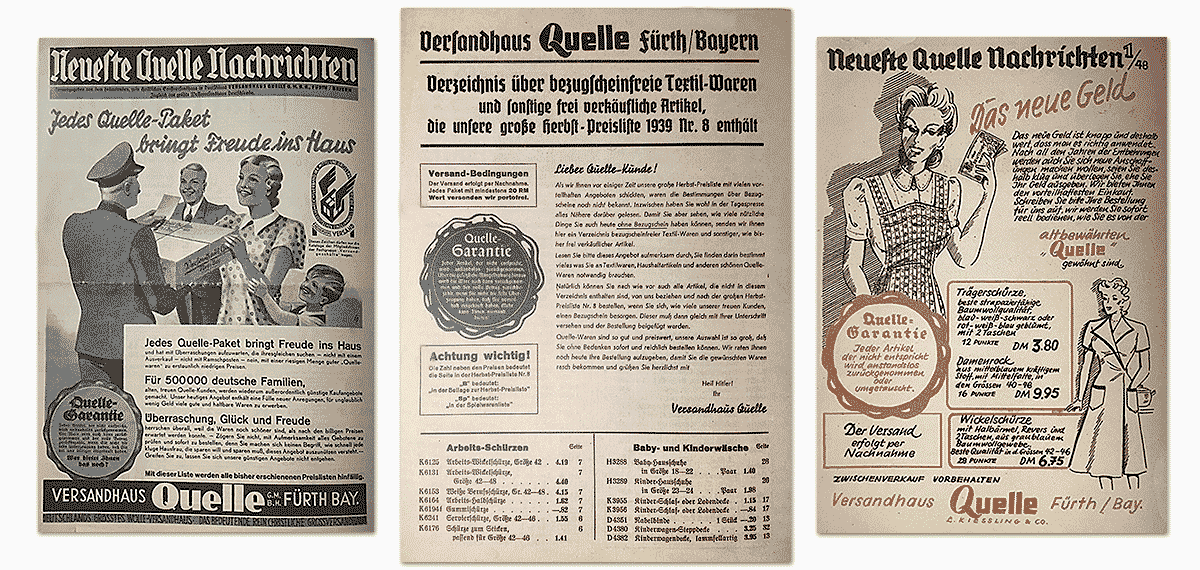
Die Quelle-Nachrichten „für 500.000 deutsche Familien“ von 1933. Daneben die Ankündigung von September 1939, dass künftig Bezugsscheine zum Erwerb vieler Waren benötigt werden und dem „Heil Hitler!“-Gruß statt den sonst üblichen freundlichen Grüßen. Rechts die ersten Quelle-Nachrichten (alles handgeschrieben und gezeichnet) nach dem Ende des nationalsozialistischen Spuks und der Währungsunion von 1948.
Die repressive Staatspolitik ließ nur eine Geschäftsstrategie der Unterordnung zu. Und eine notarielle Beglaubigung zierte die nächsten Quelle-Nachrichten, mit der Aussage, dass es sich um ein „rein christliches“ Unternehmen handelt. Solche zusätzlichen Attribute fand man fortan bei allen Drucksachen des Unternehmens, welches auch mal als „rein deutsch“ oder „rein arisch“ betitelt wurde. Gustav Schickedanz soll spöttisch vor vertrauten Mitarbeitern gesagt haben: „Wenn’s sein muss, setzen wir eben »rein narrisch« dazu.“ Trotz staatlicher Einmischung in den Markt befand man sich bei Quelle weiterhin auf Erfolgskurs. 1936 zählte man eine Million Stammkunden und die Quelle-Preislisten erreichten 1938 eine Auflage von zwei Millionen Exemplaren. Quelle verbuchte bereits einen Jahresumsatz von 40 Millionen Reichsmark und beschäftigte 600 Mitarbeiter. Als im August 1939 an Großunternehmen die streng vertrauliche Erklärung herausging, dass Bezugsscheine, Lebensmittel- und Reichskleiderkarten demnächst an die Bevölkerung verteilt werden, konnte sich die Geschäftsführung bei Quelle zusammenreimen, welche Zeiten nun bevorstanden.
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs konnte die Bevölkerung bestimmte Waren tatsächlich nur noch gegen Bezugsschein erhalten. Für das Versandhaus, das bereits mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte, waren schwere Zeiten angebrochen. Schlimmeres stand aber noch bevor. Luftangriffe im August 1943 zerstörten die meisten Betriebsgelände in Fürth, und im April 1945 wurde Quelle komplett zertrümmert. Die Restbestände waren geplündert und die große Adresskartei mit allen Stammkunden ging in Flammen auf. Gustav Schickedanz stand vor einem Scherbenhaufen, bekam von den Alliierten bis auf Weiteres Berufsverbot und musste quasi wieder bei Null anfangen. Das tat er auch drei Jahre später im provisorischen Notbüro in Fürth. Mit der Währungsreform von 1948 kam bereits der erste Nachkriegsprospekt mit 10.000 Exemplaren heraus. Die größte Herausforderung war die Neubefüllung der Adresskartei. Denn selbst wenn die alte nicht verbrannt wäre, hätte er mit ihr aufgrund der immensen Zahl an Flüchtlingen, Ausgebombten und Kriegsopfern nicht mehr viel anfangen können. Es galt, nach vorn zu blicken. Mit einem rationierten Warenangebot, das vorerst nur die lebenswichtigsten Güter enthielt.
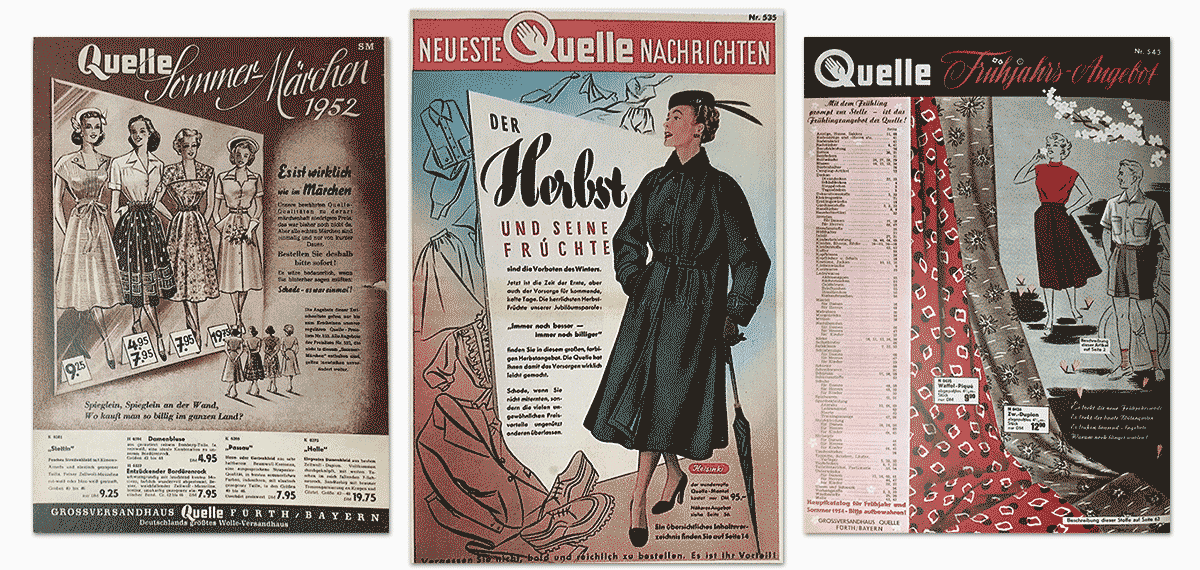
Von den alten uneinheitlichen Quelle-Wortmarken (1952) über die letzten erschienenen Quelle-Nachrichten mit neuer Unternehmens-Wortmarke (1953) hin zum ersten Quelle-Hauptkatalog von 1954.
Mit dem Ende des Krieges begannen wieder bessere Zeiten. Waren 1949 gerade einmal 45 Mitarbeiter bei Quelle wieder angestellt, so wuchs die Zahl an Angestellten und Arbeitern im Jahr 1952 auf über 2000. Und das bei einem Jahresumsatz von gut 100 Millionen DM. In Fürth eröffnete das erste Quelle-Kaufhaus und die Adresskartei war auf eine Million Kunden angewachsen. Und in Westdeutschland war alles angesagt, was irgendwie amerikanisch ausschaute. Das Zeitalter des Wirtschaftswunders begann. Man gönnte sich wieder was. Und wenn ein GI auf der Straße in Levis-Jeans herumschlenderte, konnte man sich sicher sein, diese Hosen später auch bei Quelle im Angebot zu finden. Die auffällige, neue „Freundschaftshand“ tauchte zuerst im Signet der Quelle-Nachrichten von 1953 auf und drückte nach den vielen uneinheitlichen Quelle-Wortmarken der vergangenen Jahrzehnte nun auch optisch das aus, was Gustav Schickedanz bereits 25 Jahre vorher für sein Unternehmen definiert hatte. Ein unsichtbares Band zwischen der Quelle und dem Kunden. Ein Symbol für Freundschaft, Vertrauen und Garantie. Oder kurz gesagt: Hand drauf!
Ein Jahr später löste Quelle die Preislisten („Neueste Quelle Nachrichten“) durch einen zweimal jährlich erscheinenden Hauptkatalog ab. Was plausibel klingt, hatte einen Haken. So war Quelle nun sechs Monate lang an Preise gebunden, die nicht einfach durch eine aktualisierte Preisliste aufgehoben werden konnten. Die Gefahr eines Preisverfalls war allgegenwärtig. Dennoch wuchs der Umsatz 1955 auf 160 Millionen DM bei 1,8 Millionen Kunden. Und zwischen Nürnberg und Fürth wurde ein kolossales Versandzentrum errichtet, das selbst für amerikanische Verhältnisse imposant war. Hier konnten 100.000 Sendungen pro Tag abgefertigt werden. Und Quelle entwickelte sich zum Universalversandhaus, das mit günstigen und qualitativen Eigenmarken wie „Quellux“, „Mars“ oder „Universum“ auf Kundenfang ging. 1964 wurde man offiziell das größte Versandhaus Europas. Und Quelle sollte bis zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 1977 weiter wachsen. Die 980 Seiten im Jubiläumskatalog hatten eine Auflage von 7,6 Millionen Exemplaren. Und wurden nur vom Jahresumsatz von 6,6 Milliarden DM getoppt. Ein Rekordergebnis, das Gustav Schickedanz nicht mehr erleben sollte. Er verstarb im April 1977.

Der letzte Quelle-Katalog der Fünfziger (Herbst 1959), der Frühjahrskatalog von 1962 mit Illustration statt Fotografie auf dem Cover sowie der Frühjahrskatalog von 1973 mit unverwechselbarer Mode der Siebziger.
Nach einer langen Wachstumsphase begannen die Achtziger, die durch Marktsättigung, verschärftem Wettbewerb im Einzelhandel und konjunkturellen Abschwung gekennzeichnet waren. So mussten 1981 bei Quelle erstmalig die Preise um durchschnittlich drei Prozent nach oben korrigiert werden. Trotz schwieriger Marktbedingungen hatte Quelle zu diesem Zeitpunkt den Zenit erreicht. Und in der Bevölkerung einen Bekanntheitsgrad, von dem viele andere nur träumen konnten. Knapp die Hälfte aller deutschen Haushalte bezeichnete sich laut einer Umfrage als Quelle-Kunden. Und als Kunde profitierte man vom immer aufwändiger gestalteten und dennoch kostenfreien Katalog. Der 1985 zu einem Stückpreis von 15 DM (inklusive Versand) produziert und ausgeliefert wurde. Multipliziert man dies mit der damaligen Auflage von fast 8 Millionen Exemplaren, kann man sich ausmalen, wie viel Quelle-Ware verkauft werden musste, um allein die immensen Katalogkosten zu decken.
Ein neues Quelle-Logo zierte ab 1987 den Katalog. Im Vergleich zum alten Logo wurde wenig verändert, dafür aber prägnant. Eine schnörkellose, gut lesbare Schriftart wurde verwendet, die zusammen mit der beibehaltenen Hand im „Q“ einen hohen Wiedererkennungswert bot. Leider wurde die bekannte „Freundschaftshand“ mit fortschreitender Internationalisierung des Unternehmens in den folgenden Jahren immer mehr zum Problem. Gerade die Franzosen assoziierten bei deutschen Unternehmen mit der gestreckten Hand lieber den Stechschritt als Vertrauen. So musste der vermeintliche „Deutsche Gruß“ ab dem Jahr 2000 dran glauben. Und das letzte Logo des großen Familienunternehmens betrat die Bühne. Die Hand flog ersatzlos raus und eine kursive Schrift in Majuskeln sollte es nun richten. Die dunkelblaue Wortmarke wurde durch einen zusätzlichen (und recht bedeutungslosen) roter Punkt abgeschlossen. Quelle passte nach der Kur optisch gut zum neu angebrochenen Jahrtausend, verlor dafür aber jegliches Identifizierungs- und Alleinstellungsmerkmal.

Die letzten drei Jahrzehnte des Quelle-Katalogs mit drei Logovarianten. Herbstkatalog 1986 mit dem letzten alten Logo, dann der Herbstkatalog 1991 mit neuer Wortmarke „meine Quelle“ sowie der Frühjahrskatalog von 2003 mit Zusatz der Internetadresse.
Mit dem neuen Logo wurde auch die letzte Phase des einstigen Versandriesen eingeläutet. Wobei Quelles Untergang kein Resultat eines misslungenen Logos war, sondern vielerlei andere Gründe hatte. Und die 1999 beschlossene Fusion mit der maroden Karstadt AG (ab 2007 die Arcandor-Gruppe) wahrscheinlich zu den Hauptgründen für die Misere zählt. Ende der Neunziger spürte man bei Quelle deutlich den sich verändernden Markt. Die sechsmonatige Preisbindung wurde gerade bei kurzlebiger Unterhaltungselektronik immer heikler. Quelle ging es nicht wirklich schlecht, aber schon lange nicht mehr so prächtig wie in den goldenen Zeiten der Nachkriegsjahrzehnte. Das Internet wurde zur ernstzunehmenden Konkurrenz, der Versand stockte und der Druck des Kataloges fraß Kosten in dreistelliger Millionenhöhe. Die Gleichung des Quelle-Vorstandes, dass die Fusion zweier angeschlagener Konzerne in der Summe wieder ein gutgehendes Unternehmen bringt, ging nur in der Theorie auf.
So kam es, wie es kommen musste. Im Jahr 2009 meldete Arcandor Insolvenz an und für Quelle galt: mitgegangen, mitgehangen. Das einst so prächtige Unternehmen wurde anschließend wie auf dem Basar verschachert. Die Otto-Gruppe kaufte die Namensrechte und alle anderen Unternehmensteile landeten quer über den Globus verteilt bei neuen Eigentümern. Die Folge waren lange Gesichter. Bei der DHL, wo man einen der größten Hauptkunden verlor. In ganz Fürth, wo die Arbeitslosenquote sprunghaft um drei Prozent anstieg. Und natürlich auch bei allen restlichen Mitarbeitern, die sich nun aufs Stempelgeld freuen durften. Und vorbei war es mit den dicken Quelle-Katalogen, in denen sich zu allen Zeiten nicht nur die Wirtschaftsgeschichte, sondern auch das Konsumverhalten der Deutschen widerspiegelte. Und die obendrein auch immer die eine oder andere Überraschung parat hatten.
Quelles facettenreiche Waren: „Erst mal seh’n, was Quelle hatte!“
Als 1928 der erste Quelle-Katalog mit 2500 Angeboten auf 92 Seiten erschien, herrschte eine Epoche, die von der Konsummentalität her kaum noch mit unserer modernen Wegwerfgesellschaft zu vergleichen ist. Dinge hatten ihren Wert und wenn etwas repariert werden konnte, gab es auch keinen triftigen Grund zur Entsorgung. So einfach war das. Dementsprechend das Angebot im ersten Katalog: Viel Zwirn, Gummibänder, Stahlhosenknöpfe und Ersatzteile für Hosenträger. Daneben einfache Alltagsdinge wie Taschenkämme aus Horn oder eine Mundharmonika. Bei Kindern waren Knallblättchenpistolen begehrt und für die Familie wurde der Bedarf an medizinischer Seife gedeckt, die den prekären Hygienezuständen in den Städten geschuldet war. Luxusgüter wie Schmuck, Zigarettenetuis, Tabakpfeifen und edle Herrenuhren rundeten das Angebot ab. Einige der Uhren hatten Sekundenzeiger, die mit Phosphor betupft waren, damit sie im Dunkeln leuchteten – und unbemerkt so einiges an Strahlung emittierten.
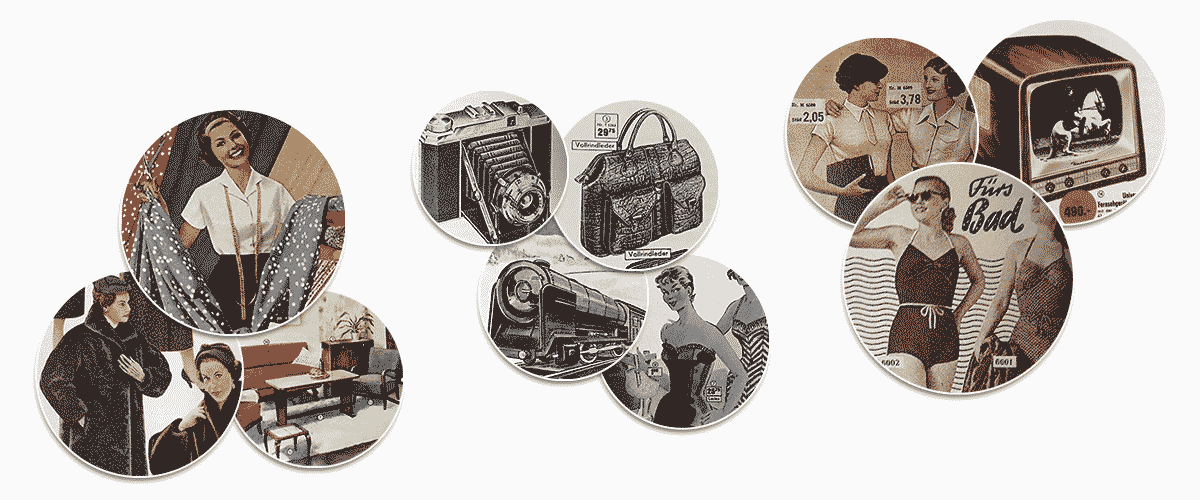
Bestellartikel der frühen Quelle-Kataloge. Darunter Mode wie Pelzmäntel (1954) und Badeanzüge (1952), Handtaschen, eine Fotokamera (1957), der erste Universum-Fernseher, eine elektrische Eisenbahn (1949), Wohnzimmereinrichtung und Stoffe zum Nähen (1959).
Kurioserweise tauchte Kleidung im Katalog erst ganz am Ende auf – also dort, wo man sie in unserer mit Textilien überschwemmten Zeit am wenigsten vermuten würde. Das lag aber nicht daran, dass Stoffwaren damals als unbedeutend galten. Im Gegenteil, mit 26 Seiten (ein Drittel des Kataloges) machten sie das Angebot komplett. Auch galt vor 90 Jahren: Das Beste kommt zum Schluss. So fand sich dort nicht nur die unverwüstliche Schürze für Hausfrauen wieder, sondern auch edle Taschentücher aus Macco-Batist. Im Dritten Reich kamen schicke Lederol-Regenmäntel hinzu, dann ein großes Spielwarensortiment, das für die Buben Soldatenfiguren, Burgen und Dampfmaschinen bot. Für Mädchen gab es Puppen und die obligatorische Strickliesel. Für eine Reichsmark konnte man auch ein Portrait des Volkskanzlers bestellen, das man sich ins Wohnzimmer, übers Bett oder an die Klotür hängen konnte. Zum Verkaufsschlager wurde der „böhmische Gefreite“ aber nicht. Man nahm ihn 1938 wieder aus dem Katalog heraus – ohne dass sich jemand beschwerte.
In den Fünfzigern kamen dann Dinge wie Fahrräder, Pelzmäntel, Möbel, Elektroherde sowie eine elektrische Eisenbahn hinzu. Und mit der Quelle-Eigenmarke „Universum“ auch ein Fernseher mit einer aus heutiger Sicht winzigen Bilddiagonale von 43 cm (16,9 Zoll). Auch wenn die Flimmerkisten damals klein und putzig waren, ging der Trend eindeutig in Richtung immer größer und imposanter. Der Höhepunkt wurde 1962 erreicht, als tatsächlich Fertighäuser im Katalog zu bestellen waren. Hatte man ein Grundstück, konnte für 65.000,– DM ein fertiges Quelle-Flachdachhaus mit wetterfester Außenhaut aus Asbestzement erworben werden. Die ersten Fertighäuser litten aber noch an etlichen Kinderkrankheiten, die einen Handwerker regelmäßig erforderlich machten. Und so verwundert es nicht, dass Mitte der Sechziger auch ein elektrischer Betonmischer im Katalog auftauchte. Mit dem jeder Hausbesitzer dann selber Bauarbeiter spielen konnte, um sein Quelle-Fertighaus reparieren zu können.

Gewehre, Flinten und Jagdbüchsen im Quelle-Katalog von 1965. Daneben die Fahrräder und Mofas der Siebziger mitsamt Bonanza-Rad und einen der ersten Elektroroller. Rechts die von 1970 bis 1976 im Katalog angebotenen Rassehunde.
Zur selben Zeit führten vermehrte Anfragen von Jägern und Sportschützen dazu, dass fortan auch Waffen und Munition im Katalog mit gelistet wurden. Und damit waren keine Erbsengewehre oder Wasserpistolen gemeint, sondern scharfe Jagdbüchsen, Karabiner sowie eine doppelläufige Schrotflinte, mit der man der Haustür des ungeliebten Nachbarn ein Loch in der Größe eines Gullydeckels verpassen konnte. Nach heutigen Maßstäben alles recht befremdlich. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass in den Sechzigern trotz „Hottentottenmusik“ und revoltierenden Studenten auf LSD die Welt ja noch (irgendwie) in Ordnung war – und Flinten tatsächlich nur für Jagd- und Sportzwecke bestellt wurden. Mit dem ersten bundeseinheitlichen Waffengesetz von 1970 musste Quelle dann so langsam die Flinten ins Korn werfen. Und mit dem verschärfte Waffengesetz von 1976 hatte der Gewehrverkauf dann endgültig keinen Lauf mehr.
In den Siebzigern kam man bei Quelle dann auf den Hund. Was wie Satire klingt, wurde tatsächlich einmal praktiziert. Ab 1970 wurden echte Rassehunde (inkl. Bestellnummer und Preis) mit Ahnentafel im Katalog angeboten. Tierschützer wären sicherlich fassungslos über die Tatsache, dass Lebewesen einst wie Ware im Quelle-Katalog angeboten wurden. Andererseits, wie viele thailändische Ehefrauen haben in den letzten Jahrzehnten über einen Katalog hier ihren neuen Besitzer gefunden? Das wirklich skurrile an der Sache aber war, dass Umtauschrecht und Quelle-Garantie natürlich auch hier galten. Spreich, man den Hund bei Nichtgefallen einfach umtauschen und wieder zurückschicken konnte. Immerhin achtete man beim Tierversand auf artgerechte Express-Versandbedingungen mit ausreichend Nahrung und Flüssigkeit. Der Käufer musste somit nicht befürchten, dass der Hund beim Öffnen des Paketes schon das Zeitliche gesegnet hat. Oder der Postbote, wie heutzutage der Hermes-Typ, das Paket zwei Straßen weiter irgendwo im Vorgarten deponiert. Aufgrund des hohen innerbetrieblichen Aufwands wurde der Tierversand dann 1976 eingestellt.
Herbstkatalog 1986 – Rückkehr in die skurrilen Achtziger
In den Achtzigern hatte sich dann einiges verändert und dem Zeitgeist entsprechend angepasst. Flinten und Hunde waren zwar rausgeflogen, dafür hielten die Kataloge aber neue Überraschungen parat. Der Herbstkatalog von 1986 war so ein 1121-Seiten umfassendes Mammutwerk. Und der letzte seiner Art, der noch das alte Logo trug, das seit 1953 das Unternehmen zierte. Öffnet man nach über 30 Jahren diesen antiken Wälzer, taucht man zuerst in 500 Seiten Modewelt der Achtziger ein und findet etliche Sachen wieder, die längst verdrängt und vergessen sind. Mit Cordhosen, Karopullovern aus Schurwolle, dem Kittelett für Hausfrauen, langen Doppelripp-Unterhosen und mehrere tausend Mark teuren Echtpelzen (inklusive Waschbärmütze) bestätigt sich das modische Gruselkabinett, welches man rückblickend mit dieser Ära assoziiert. Neben uriger Kleidung gab es aber noch weitaus größere Kracher.
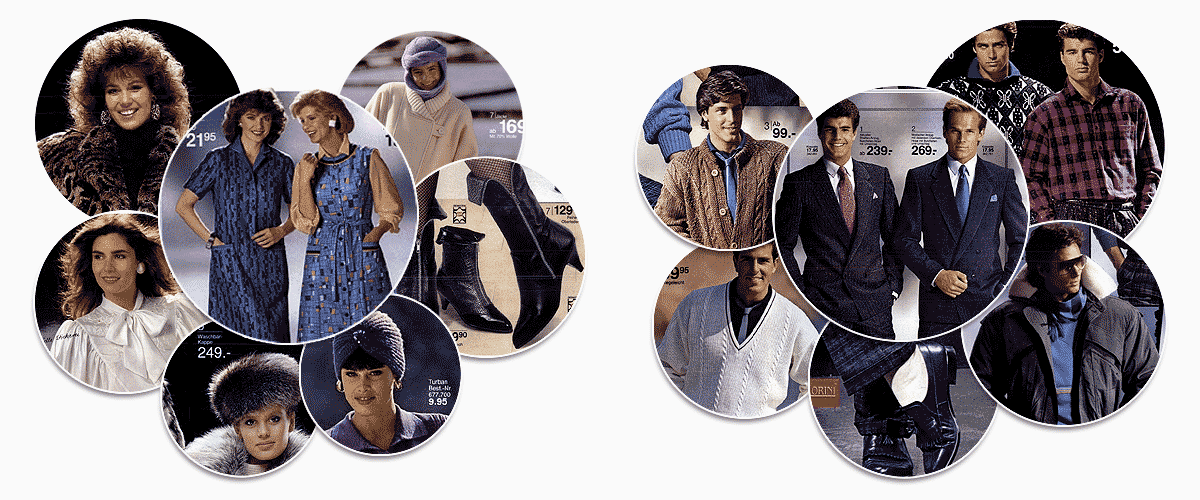
Modewelt von 1986: Damenmode mit viel Strickmaterial, der Waschbärmütze, einem Turban, Echtpelz sowie dem Kitelett für Hausfrauen. Daneben die Herrenmode mit Bundfaltenhosen, den weißen Tennissocken, einer Pilotenjacke und den typischen Anzügen der Achtziger.
Wie zu erwarten, beginnt die Reise in die Vergangenheit mit 300 Seiten (aus heutiger Sicht) ziemlich altbackener Mode – genauer gesagt Frauenmode. Wo es bis auf Unterwäsche kaum ein Kleidungsstück gab, das nicht auch als Strickvariante existierte. Stricken war in den Achtzigern offensichtlich im Trend. Man erblickt längst ausgestorbene Kombinationen wie Steghosen zu pastellfarbenen Socken, Nerz-Imitate mit Schulterpolstern und karierte Blusen mit überdimensionalen Ziergürteln. Und natürlich den Strickturban, passend zu Strickpullover und Strickrock. Als nächstes folgt die Kinder- und Jugendmode, die ebenfalls kaum biederer hätte ausfallen können. Trug man als Vierzehnjähriger damals wirklich Bundfaltenhosen mit Jacquard-Pullovern? Oder Tweed-Blousons in Kombination mit Cordhosen? Das Angebot im „Junior Shop“ wirkt schon unfreiwillig komisch, was durch die Sonnenbrillen noch verstärkt wird, die man den halbwüchsigen Models plakativ auf die Nase setzte.
Die knapp 100 Seiten Herrenmode kommen erwartungsgemäß nicht ohne weiße Tennissocken in schwarzen Lederschuhen einher. Und auch hier Unmengen an Cord-Bundfaltenhosen, die zu Jacken aus Nappaleder kombiniert wurden. Oder Holzfällerhemden, die man zu melierten Breitcordhosen mit Umschlag trug. Einfache Jeanshosen sucht man lange Zeit vergebens, findet dann auf einer einzigen Seite aber doch noch welche. Bei der einen handelt es sich um eine Bundfalten-Jeans mit Karodruck. Sehr schick. Die andere schaut immerhin wie eine echte Jeans aus, entpuppt sich bei näherer Betrachtung aber als Stretchjeans mit Elasthananteil. Diese Unsitte ist also auch eine Erfindung der Achtziger? Hätte man sich ja denken können. Nach all den Scheußlichkeiten findet sich bei den Sportschuhen dann etwas Balsam. Beim Anblick der alten Adidas „Marathon“ oder „Boston“ werden Erinnerungen an zeitlose Sneaker wach, die noch heute eine gute Figur abgeben.
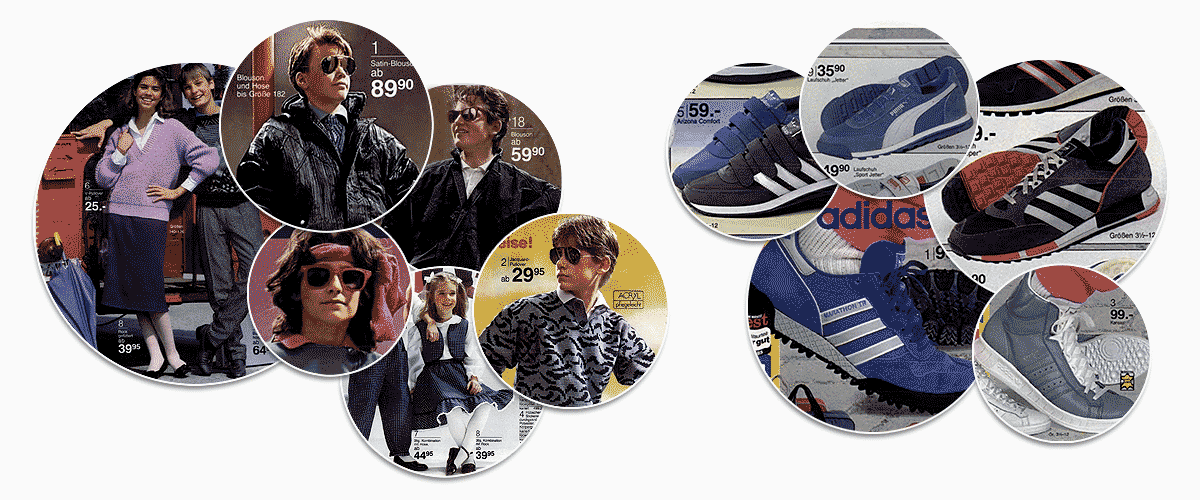
Kinder- und Jugendmode 1986: Tweed-Blousons in Kombination mit Cord- und Bundfaltenhosen. Daneben die Lauf- und Sportschuhe, wie die Adidas Marathon, Kansas, Arizona, Boston sowie die Jetter von Puma.
Hat man den Klamottenteil geschafft, gelangt man über Handtaschen und Schulranzen zum Juwelier. Bei den Ranzen gibt es noch ein Wiedersehen mit dem streng quaderförmigen „McNeill“-Ranzen (der mit dem Hund), den man bei jedem zweiten Schulkind damals sah. Der folgende Schmuck der „Gold-Quelle“ ersparte einen den Weg zum Goldschmied. Man musste für einige Produkte allerdings tief ins Portmonee greifen. Bei den 140.000 Paketen, die Quelle zu der Zeit täglich verschickte, konnte durchaus mal ein Platinring für 1600,– DM oder eine 585er-Herrenuhr für 3000,– DM mit dabei sein. Eine einfache Quarzuhr für 12,– DM findet sich ein paar Seiten später auch. Blättert man bei den Uhren weiter, stolpert man über einen Trend, der aktuell wieder angesagt ist. Intelligente Computeruhren gab es nämlich schon damals. Die konnten im Vergleich zur „Apple Watch“ zwar noch nicht den Menstruationszyklus aufzeichnen, punkteten aber mit Mini-Datenbank, Taschenrechner und Stoppuhr für unschlagbare 179,– DM.
Mitte der Achtziger rückte das Thema Gesundheit immer mehr ins Blickfeld. So wundert es nicht, dass Quelle auch hier mit einigen Seiten Blutdruckmessgeräten, Inhalationsmasken sowie einer elektrischen Akupunkturmaschine für 349,– DM auftrat. Die laut Katalog bestens bei Sonnenbrand, Verstopfung und Alkoholkater helfen sollte. Praktisch, die Nacht durchzechen und sich am nächsten Morgen eine Elektronadel irgendwo reinpieksen. Das hätte jeden Heilpraktiker vor Neid erblassen lassen. Der Hygieneteil wurde dann mit Kondomen, Medizinal-Schutzhosen, flotten Mini-Monatsslips sowie einem Massagestab im Penislook abgerundet, mit dem sich die abgebildete Dame die Schulter massiert. Unmittelbar nach den Kondomen folgt die Malseife für Kinder, mit der man den Nachwuchs beim Baden kunterbunt mit Lebensmittelfarbe einfärben konnte. Vielleicht waren die Kondome direkt davor als versteckter Hinweis gedacht, damit einen das Kindereinfärben einmal erspart bleibt?
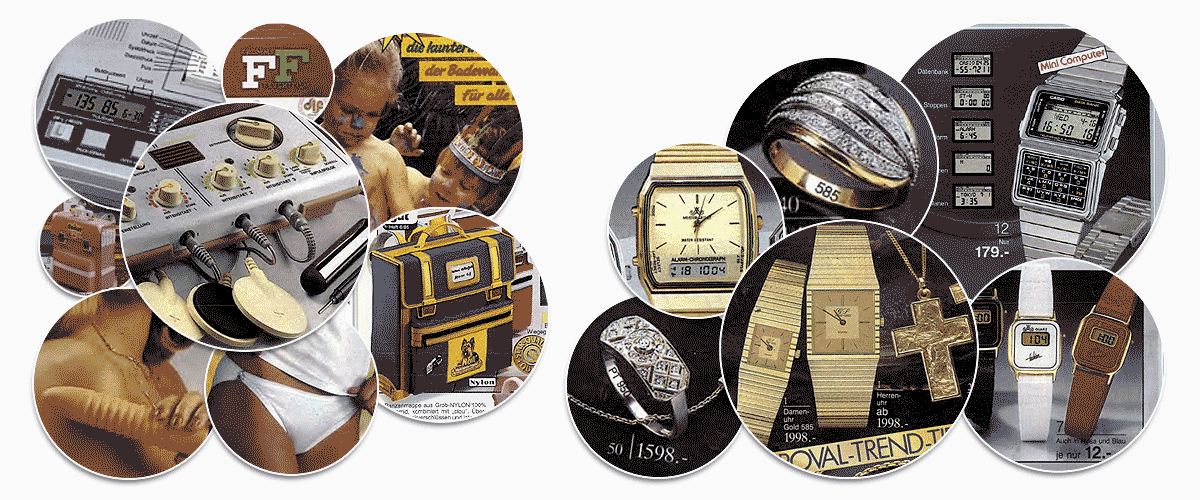
Gesundheits- und Hygieneartikel von 1986: Die elektrische Akupunkturmaschine, Blutdruckmessgerät, McNeill- und Scout-Schulranzen, Kondome, Malseife für Kinder, der flotte Monatsslip und der als Massagestab getarnte Gummidödel. Rechts daneben die intelligente Computeruhr, Platin- und Diamantringe, eine Meister-Quarz-Uhr sowie echte 585er Golduhren.
Mit der Kinderfarbe hat man dann die Hälfte des Katalogs geschafft. Und wem viele Dinge noch nicht schräg genug waren, der blättert einfach ein paar Seiten weiter, wo die Zweitfrisuren den Vogel abgeschossen haben. Angeboten als besonders natürlich und „von echtem Haar kaum zu unterscheiden“. Fast so natürlich wie ein Brusthaartoupet bei Teenagern. Das Modell „Steffi“ schaute übrigens aus, als hätte man einen dieser Pudel auf dem Kopf, die zehn Jahre zuvor noch per Paket verschickt wurden. Und das chromfarbene Modell „Lady“ war wohl für jene Männer gedacht, die ihre Gattin mal als Greisin begehren wollten. Nach den Frisuren folgt noch einmal das Lieblingshobby der Achtziger: Strickgarn, Häkelzeug, Nähmaschinen und alle Utensilien, die man als Strickliesel damals brauchte. Für ganz Eifrige gab es einen Heimstricker mit Lochkarten-Automatik für 1400,– DM, mit dem man problemlos die ganze Familie einstricken konnte.
Wenn es heißt, bei Quelle konnte man fast alles bestellen, egal wie groß und schwer, dann kam das der Wahrheit ziemlich nahe. So staunt man noch heute über die reichhaltige Inneneinrichtung, die fast wie ein eingeschobener IKEA-Katalog wirkt. Mehrere hundert Seiten mit Teppichen, rustikalen Polstermöbeln, Wandschränken, Betten, Sitzecken und kompletten Küchen samt Einbaugeräten. Ein gigantisches Möbelhaus in Katalogform. Und nicht nur bei Weißer Ware hatte Quelle einiges zu bieten. Selbst ein Luxus-Kachelofen sowie eine 4000,– DM teure Sauna mit 9-kW-Steinofen konnte man bestellen. Um den Einbau musste man sich auch keine Gedanken machen, die hat der Quelle-Kundendienst gegen Aufpreis gleich mit übernommen. Alles wurde fertig montiert und angeschlossen. Nur den passenden Saunameister (samt Holzkelle und Aufgusseimer) musste man selber stellen.
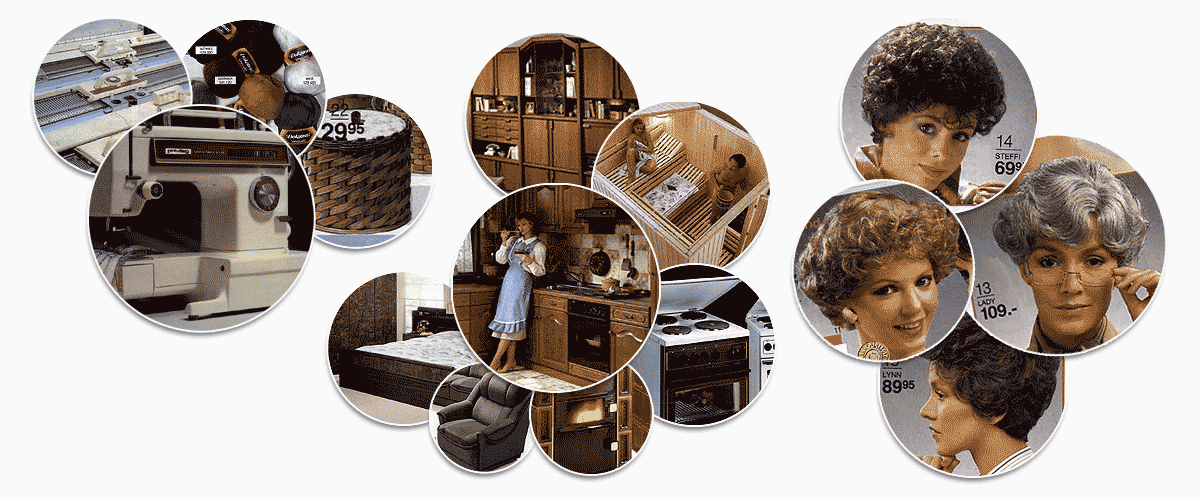
Privileg-Nähmaschine, Heimstricker und Utensilien für die Heimarbeit. Daneben die Inneneinrichtung mit Landhausküche, einen Herd der Achtziger sowie einer kompletten Sauna. Rechts daneben die authentischen Zweitfrisuren „Steffi“, „Bijou Luxus“, „Lady“ und „Lynn“, die man für den Rosenmontag noch heute gut nutzen könnte.
Nach gut 900 Seiten voll mit Klamotten, Schmuck und Inneneinrichtung wurden dann die Fans der Unterhaltungselektronik bedient. Bei den Spielkonsolen gab es überraschenderweise nur den „Atari 2600“ für 129,– DM zu erwerben. Nintendo und Sega sucht man vergeblich. Anschließend folgen Videorecorder, die nur noch im VHS-Format angeboten wurden. Video 2000 sowie Betamax landeten mit dem Ende des Formatkriegs (1984) auf dem Elektroschrott. Bei den Leerkassetten hingegen gab es noch alle drei Formate. Ein Zweierpack „Sony VCC-480“ kostete satte 59,– DM, ein VHS-Recorder gleich bis zu 2600,– DM. Noch bizarrer die Preise für Filme. Ein „Bud-Spencer“-Schinken kostete nicht weniger als 99,95 DM. Da wird einen klar, warum es Videotheken damals so gut ging. Bei den folgenden Fernsehern gab es noch den sogenannten „Mietkauf“. Sechs Monate lang für 100,– DM pro Monat mieten und dann die Kaufoption (in der Regel gut 100 DM höher als der Normalpreis) ziehen. Und wenn nicht, dann hatte man für 600,– DM ein halbes Jahr lang einen Fernseher gemietet.
Wollte man in den Achtzigern hip sein, musste ein Ghettoblaster her. Das hatte man sich von den Amis abgeschaut, wo in den Wohngebieten sozial benachteiligter Afroamerikaner jeder im Jogginganzug (inkl. Sonnenbrille und Goldkette) damit herumlief. So wurde es zumindest im TV dargestellt. Und es dauerte nicht lange, bis auch Quelle so ein fettes Gerät für 598,- DM anbot und man hierzulande erste Jugendliche sah, die einen Radiorekorder auf der Schulter mit sich herumschleppten und die Mitmenschen nervten. Also eigentlich dasselbe taten wie die Rotznasen heute mit ihrem Smartphone. Nur hatte so ein 30-Watt-Rekorder, den man auch an die Autobatterie anschließen konnte, weitaus mehr Druck als ein fragiles Mobiltelefon. Und war man richtig trendy, dann gönnte man sich statt Walkman einen „handlich für unterwegs“ entworfenen, portablen CD-Player. Man musste nur noch einen passenden Rucksack für dieses 698,– DM teure Gerät in der Größe eines Toasters irgendwo finden.

Unterhaltungselektronik 1986: VHS-Videorecorder, der Atari-2600, Sony-Camcorder, hochwertiger Fernseher und Videocassetten. Rechts daneben ein HiFi-Turm, Stereoanlage, portabler CD-Player, Ghettoblaster und Walkman.
Mit der Computerabteilung nähert man sich dem Ende des Kataloges und staunt noch einmal über die aus heutiger Sicht unverhältnismäßigen Preise. Ein C64 mit Zubehör kostete 498,– DM. Für das passende Diskettenlaufwerk „1541-Floppy“ musste man 548,– DM berappen. Ein früher Atari ST kam auf 998,– DM, das Diskettenlaufwerk kostete vergleichsweise günstige 399,– DM. Dafür musste man für eine einfache Atari-Maus mit Rollkugel stolze 148,– DM hinblättern. Und dann entdeckt man ein ausgestorbenes Relikt, das heute vermutlich kaum noch jemand kennt. Das offiziell von der Bundespost zugelassene „Dataphon S21“ (Akustikkoppler) für 249,– DM. Ein Gerät in der Form eines Telefonhörers, mit dem man digitale Signale über die analoge Telefonleitung übertragen konnte. Die Schrittgeschwindigkeit betrug 300 Baud, d. h. der analoge Kanal konnte 300 mal pro Sekunde seinen Zustand ändern. Bei binärer Kodierung hätte man mit einer ein Megabyte großen Datei für acht Stunden die Telefonleitung der Eltern blockiert.
Der Computerecke folgt noch einmal ein Bereich mit schwer einzuordnenden Dingen. Darunter ein 300 Kilogramm schwerer Tresor für 1499,– DM. Angeliefert wurde das Trumm durch ein Spezial-Transportunternehmen, das aber nur bis hinter die erste Tür ins Erdgeschoss lieferte. Wohnte man im Wiesbadener Altbau und hatte keinen Fahrstuhl parat, konnte man natürlich versuchen, mit den Spediteuren den Weitertransport nachverhandeln – die einen dann den Vogel zeigten und die Durchwahl der Vermietung für Schwerlastkräne in die Hand drückten. Nach Diaprojektoren und Kochgeschirr fällt mit der „sprechenden Waage“ dann wohl eines der schrägsten Highlights im Katalog auf. Diese „Sie-haben-schon-wieder-zugenommen!“-Alexa kommentierte einen tatsächlich jede Gewichtsveränderung mit Roboterstimme. Und man fragt sich im Nachhinein, wie viele dieser Waagen damals bei verärgerten Hausfrauen aus dem Fenster geflogen sind.

Computer von 1986: Der C64, ein Dataphon, eine 1541-Floppy, Joyball, ein C128 mit Monitor, eigene Spiele-Software aus dem Hause Quelle sowie ein Atari ST. Rechts daneben die sprechende Waage, ein Tresor, Diaprojektor, der 15-Liter-Jumbotopf und Zinngeschirr.
Ist man ein Kind der späten Siebziger, wird einen beim Anblick der folgenden Seiten leicht sentimental zumute. Denn vieles der Spielwarenabteilung stand zu der Zeit auch im eigenen Kinderzimmer herum. So eine Ritterburg hatte wohl jeder Zehnjährige. Und auch ein Fernlenkauto sowie eine Autorennbahn. Zu meiner Überraschung fand ich beim Durchblättern des alten Katalogs auch das BMX-Rad „Blue Mile“ der Quelle Eigenmarke „Mars“ wieder, mit dem ich noch bis in die späten Achtziger Weitsprünge übte und mir den „Bunny Hop“ beibrachte. Und dann entdeckt man mal wieder etwas zum Schmunzeln: Ein echter Geldspielautomat inmitten von Babyschaukeln, Kinderfahrrädern und Spielzeugautos. Mal davon abgesehen, dass es ziemlich sinnfrei ist, sich einen Glücksspielautomaten zum Selberbefüllen in die Wohnung zu stellen. Weitaus amüsanter: Wer auch immer den Katalog damals bestückten musste – einen Geldspielautomaten unter „Spielwaren“ zu kategorisieren war nun wirklich keine Glanzleistung.
Auf den letzten Schlemmerseiten kommt es dann noch einmal knüppeldick. Es irritiert einen nicht nur, dass die angebotenen Kalorienbomben wie Lebkuchen, Schichtnougat und Weihnachtstrüffel ausschließlich im wuchtigen Kilopack verkauft wurden. Weitaus köstlicher ist, dass man direkt nach dem süßen Zeugs ohne jede Vorwarnung in der Schlachtabteilung landet. Wo Unmengen an Blut- und Leberwurst, Bauchspeck sowie der Jahresvorrat an Schwarzwaldschinken jedem heutigen Veganer die Lichter ausgeblasen hätten. Zuletzt stolpert man dann noch über einen Eimer Honig. Und fragt sich, welcher Kulturbanause sich damals zwei Liter Honig im Blecheimer bestellen musste? Als allerletztes Katalogprodukt findet man dann als Krönung die Riesenflasche Melissengeist zum Einnehmen – bei Magen- und Darmbeschwerden. Humor hatte Quelle, das kann man nicht anders sagen.
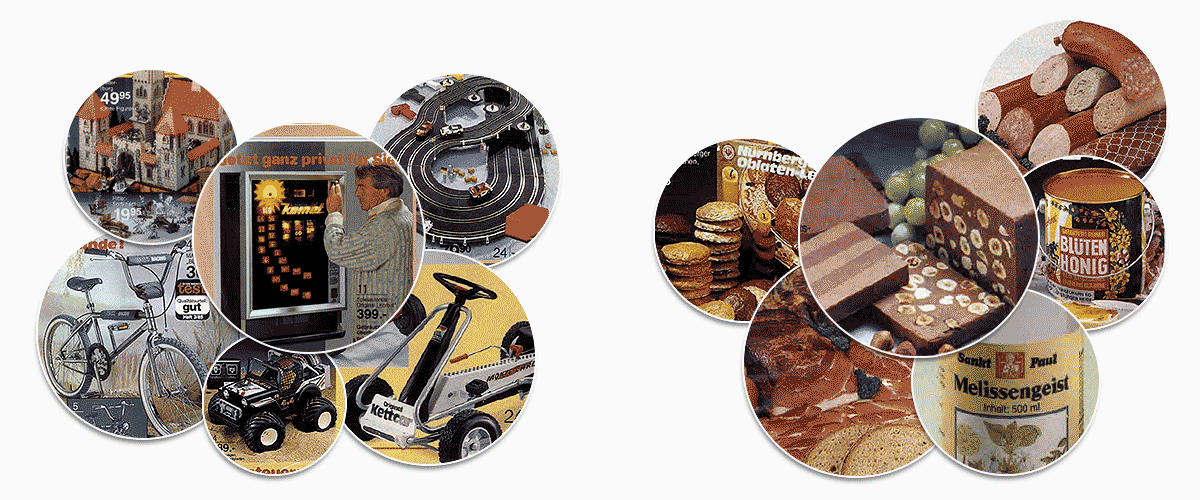
Fahrräder und Spielwaren 1986. BMX-Rad „Blue Mile“ für 309,– DM, Kettcar, Fernlenkauto, Ritterburg, Autorennbahn sowie ein echter Geldspielautomat. Rechts daneben das Schlemmerset bestehend aus Schichtnougat und Nürnberger Lebkuchen. Dann Wurst und Schinken im Kilopack, der 2-Liter-Honigeimer sowie Melissengeist zum Einnehmen.
Quelle Technorama – als Technikläden noch unterscheidbar waren
Technikfachmärkte sehen heutzutage alle ziemlich gleich aus. Es gibt ja auch nur noch ein Unternehmen, dem die beiden bekanntesten Märkte gehören: „Soo! muss Technik.“ Und wo immer man eine nach demselben Schema konfektionierte Elektrowelt entdeckt, so richtig Neuland betritt man danach nie wieder. Kennt man einen Laden, kennt man alle. Kunden sollen ja auch nicht entdecken, sondern kaufen. Und das macht in dieser Zeit kaum noch Spaß. Überall blinkt und dudelt es, die Märkte sind lichtüberladen, grell und voller sich endlos wiederholender (sinnfreier) Botschaften. Was Reizüberflutung betrifft, wäre etwas „Geiz schon geil“. Denn hat man sich eingangs am Handyvertrag verticktenden Osmanen hinterm Stehpult vorbeigemogelt, landet man früher oder später bei den Fernsehern, die es schon in der Größe eines Garagentors gibt. Und die alle durcheinander den Raum beschallen. Man fragt sich, warum man nicht einfach den Ton abstellt? Zu viel Reiz scheint gegenwärtig eher gezielte Marketingstrategie als Unachtsamkeit zu sein. Denn die „sind ja nicht blöd“ – und wissen, wie das gemeine Volk tickt.
Als Entdecker mit Hang zur Einfachheit hatte man früher bessere Karten. Nicht nur, weil es in den Geschäften optisch und akustisch weitaus ruhiger war. Es gab neben den großen Elektrohandelsketten ja noch viele kleine und mittelgroße Technikhäuser. Eines dieser Häuser waren die Quelle-Technikläden, die sich seit den endenden Achtzigern als Quelle Technorama dem Kunden vorgestellt haben. Das Kunstwort „Technorama“ lud schon damals zum Nachdenken ein, lieferte Quelle nie eine Erklärung, was Technik gerade mit einer Inkarnation von Vishnu – oder einer Margarine gemein hatte. Auch hatte sich der verantwortliche Namensgeber offensichtlich keine Gedanken über die Steilvorlage gemacht, dass inmitten des Wortes ein „d“ vergessen sein könnte. Und so eigenwillig der Name, so individuell die Läden. Was für mich als Kind natürlich großartig war, gab es bei Quelle immer reichlich zu entdecken.
- Computerzubehör (Bremerhaven, 1988)
- Computerabteilung (Bremerhaven, 1988)
- Weiße Ware (Bremerhaven, 1988)
- Atari 2600 und Sega Master System (Bremerhaven, 1988)
- Foto-Quelle (Bremerhaven, 1988)
- Alte Fernsehabteilung (Bremerhaven, 1984)
Da ich aufgrund meines Elternhauses quasi direkt an der Quelle saß, hatte ich schon ab den Achtzigern das Glück, viele der Läden im norddeutschen Raum kennenzulernen. Von Bremen über Bremerhaven, Minden, Emden, Leer oder Wilhelmshaven. Wenn sich Gelegenheit ergab, bin ich zur Arbeit einfach mitgefahren, verbrachte den Tag in der Quelle-Welt und erkundete nebenbei die Innenstadt. Die Quelle-Exkursionen brachten neben Entdeckererfahrung auch regelmäßig Werbegeschenke wie Schreibutensilien oder die legendäre Quelle-Baseballmütze mit eingebautem Radio und ausfahrbarer Antenne mit heim. Zu der Zeit waren Technikhäuser inmitten einer Innenstadt ja noch gang und gäbe. Heute ist das eher die Ausnahme und Elektrohandelsketten nisten sich lieber zusammen mit Modegeschäften in ausgedehnten Einkaufszentren der Pampa mit ein. Was zwangsläufig zu den räumlichen Wüsten führt, die wir heute so haben. Da Quelle stets Bestandsgebäude in den Innenstädten anmietete, waren die auch alle sehr unterschiedlich und von außen nicht voraussagbar. Verwinkelte Ecken über mehrere Etagen gab es oft, eine alte Wendeltreppe der Gründerzeit tauchte auf, und die Keller glichen in einigen Altbauten fast Katakomben.
In so einem unterirdischen Komplex fand ich als Zwölfjähriger auch meinen allerersten Job. Zur Ferienzeit beklebte ich in Bremen im historischen Bau der Obernstraße Quelle-Kataloge mit neuen Aufklebern – und gab den Lohn zwei Etagen höher für C64-Spiele gleich wieder aus. Die Computerabteilungen bei Quelle hatten es bekanntlich in sich, fanden sich dort immer wieder Raritäten, die es schon lange nirgendwo anders mehr gab. Ob es nun Module für längst ausgestorbene Atari- oder ColecoVision-Systeme oder für ein paar Mark ein C64-Spiel auf Kassette war, das in geringer Auflage irgendwann mal erschien – bei Quelle fand man solche Dinge in der Software-Grabbelkiste immer wieder, man musste nur lange genug wühlen.
- Außenansicht (Detmold, 1991)
- Foto-Quelle (Detmold, 1991)
- Weiße Ware und vergessener Tapeziertisch (Minden, 1986)
- Provisorische Quelle-Fundgrube (Minden, 1986)
- Außenansicht mit veraltetem Logo (Lingen, 1995)
- Nähmaschinen (Lingen, 1995)
Nicht nur in Sachen Architektur waren die Quelle-Läden einprägsam, auch bei der Inneneinrichtung fand man die volle Bandbreite von behelfsmäßig über funktional bis hin zu edel. Einige Filialen, wie die in Bremerhaven oder die letzte (nach insgesamt vier Umzügen) in der Bremer Knochenhauerstraße, präsentierten sich aufgeräumt und unaufdringlich im schlichten Grau. Für die Produkte wurden einfache Regale an den Wänden befestigt, Preisschild dazu und fertig. Kein Dauergeblinke, keine bunten Neonröhren, nur das ausgepackte Produkt wie die Fabrik es schuf.
Bei Quelle sah man viele Dinge insgesamt entspannter. In Lingen zierte beispielsweise noch 1995 das seit acht Jahren veraltete Logo den Geschäftseingang. Die aktuelle Wortmarke fand sich direkt daneben auf Folie in eines der Fenster geklebt. Heutzutage undenkbar, da steht bei einem neuen Unternehmensanstrich gleich am nächsten Tag die Marketingabteilung vor der Tür und drängt zum Austausch aller Wortmarken. Moderne Unternehmen fürchten nichts mehr als eine uneinheitliche Präsentation – wobei das den Kunden damals ziemlich egal war, welche Logovariante da rumhing.
Einige der Technikläden hatten mit der „Quelle-Fundgrube“ einen abgetrennten Bereich, wo überschüssige, Umtausch- und Restware zu reduzierten Preisen angeboten wurde. In Minden fand sich Mitte der Achtziger so ein Laden, der eh schon einen recht provisorischen Eindruck mache. Und wo auch mal ein vergessener Tapeziertisch im Verkaufsraum tagelang rumstand. Das alte Lager wurde pragmatisch zur Fundgrube umfunktioniert und Textilien wie auf „Rudis Resterampe“ mit zigmal überklebten Preisschildern hingestellt. Bei den Leuten kam es gut an und der Verkauf wurde zum Hit.
- Kücheneinrichtung (Ehem. Warenhaus Bielefeld, 1988)
- Staubsauger (Ehem. Warenhaus Bielefeld, 1988)
- Fernsehabteilung (Ehem. Warenhaus Bielefeld, 1988)
- Schallplatten (Ehem. Warenhaus Bielefeld, 1988)
- Medienabteilung (Ehem. Warenhaus Bielefeld, 1988)
- Foto-Quelle (Ehem. Warenhaus Bielefeld, 1988)
Als Kontrast zu den vorwiegend funktional gehaltenen Technikhäusern gab es bei Quelle auch noch die 20 Warenhäuser, von denen mit der Zeit allerdings immer weniger übrig blieben. Bielefeld beherbergte seinerzeit eines der größten Kaufhäuser, wurde Ende der Achtziger zu Technorama verkleinert und spielte weiterhin von der Aufmachung her in einer ganz anderen Liga als die meisten Technikläden. Die einzelnen Verkaufsbereiche waren opulent, unaufdringlich und edel gestaltet. Und man bekam es hin, ein abgerundetes Erscheinungsbild zu präsentieren, das ohne aggressives Werbediktat zum Wiederbesuch einlädt. Und das konnten nicht nur die Quelle-Kaufhäuser, sondern eigentlich alle großen Warenhäuser zu jener Zeit. Ob sie nun Karstadt, Hertie oder Horten hießen. Soo! waren Achtziger.
Und so war auch Quelle, genau wie Gustav Schickedanz es visionierte: Die Balance zu wahren zwischen den einfachen Dingen mit minimalster Präsentation und gleichzeitig das Hochwertige, Edle und Besondere zu pflegen. Und dabei niemals die Qualität aus den Augen zu verlieren. Wo andere nur billig konnten, überzeugte Quelle mehr als achtzig Jahre mit der einfachen aber fundierten Devise: „Verbrauchsfähigkeit geht über Verkaufsfähigkeit.“ Und nun ist die Quelle versiegt. Und die Zeiten lange vorbei, wo man den Einkaufsbummel auch mal als Inspirationsquelle nutzen konnte. Man freiwillig und ohne Stress sogar länger als nötig im Geschäft verweilte. Weil die Atmosphäre stimmte, man vielleicht noch etwas entdecken konnte oder einfach, weil es eine andere Zeit war, wo der stumpfe Kommerz einen noch nicht so angepisst hat. Und damit geht das Schlusswort an ein 1957 von Gustav Schickedanz an seine Kunden verfasstes Zitat, das viele Jahre später zum bekannten Quelle-Slogan wurde: „Ein Glück, dass es die Quelle gibt gab!“



























5 Kommentare
Weiss jemand ob Quelle in Bielefeld den standort gewechselt hatte?
Mega Artikel, gerne gelesen und in Wehmut verfallen:)
Ein toller Artikel! Wir waren in den 80ern alle paar Wochen in Emden bei Quelle, das Geschäft war ca. 25 KM entfernt. Aber am liebsten habe ich als Kind natürlich in den Quellekatalogen geblättert und angekreuzt, was ich gerne geschenkt bekommen würde. Daher war ich natürlich auch heiß auf die Herbst-Winter-Ausgabe, da es darin immer viel mehr Spielsachen gab. Irgendwann bekam ich dann endlich den Agentenkoffer, ein kleines Computerspiel, was man sogar an die Wand projezieren konnte und das beste war der Atari 2600. Nichts wurde aus den Batteriebetriebenen Motorrädern oder Autos. Aber wahrscheinlich wäre ich davon auch enttäuscht gewesen.
Danke für den nostalgischen Trip! 🙂
Ich bin fasziniert von diesem Artikel. Ich selbst besitze noch die ersten CD Kataloge die 5DM kosteten.
Hallo, erstmal schön geschrieben von dir. Die Quelle-Warenhäuser wurden spätestens Anfang der 90er aufgelöst. Zum Beispiel übernahm HERTIE ein Teil der Häuser (z.B. Koblenz und Hagen) und die Quelle „Tochter“ Sinn(&Leffers) bekam auch welche. In Hamburg wurde das Warenhaus nach Auszug der Quelle komplett mit dem Einkaufzentrum umgebaut und als toom SB Warenhaus wiedereröffnet (auch schon lange Geschichte). ich meine das Haus in Fürth auf den Gelände der Quelle blieb aber noch erhalten als Warenhaus. Versandhäuser mit Warenhäuser waren früher total „in“. Neckermann und OTTO hatten auch eigene Häuser, letztere aber nur 4 Jahre.